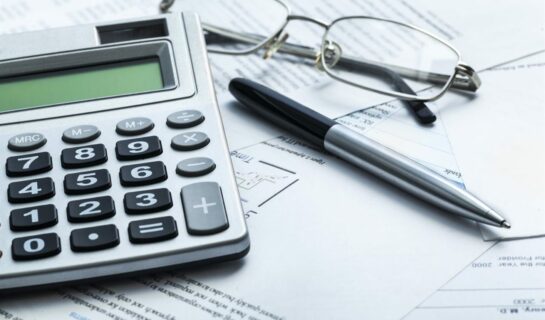LG Itzehoe – Az.: 6 O 336/17 – Urteil vom 26.07.2019
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
4. Der Streitwert wird auf 9.094,75 € festgesetzt.
Tatbestand
Die Klägerin verlangt von den Beklagten Schadensersatz wegen eines Verkehrsunfalles.
Unfallbeteiligt waren der klägerische PKW Seat Altea mit dem amtlichen Kennzeichen …, dessen Halterin die Klägerin ist, sowie der von dem Beklagten zu 2) gesteuerte PKW Opel Astra Caravan mit dem amtlichen Kennzeichen …, dessen Haftpflichtversicherer die Beklagte zu 1) ist.
Am Nachmittag des 18.07.2017 fuhr die Klägerin mit ihrem PKW rückwärts aus der Einfahrt ihres Grundstückes auf den … in …. Der … besteht aus einem ca. 3 m breiten, asphaltierten Fahrstreifen. Rechts und links dieses Fahrstreifens befinden sich befestigte Schotterstreifen, die jeweils wiederum eine Breite von ca. 1 bis 1,5 m haben. Im … gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Der Beklagte zu 2) näherte sich mit seinem Fahrzeug, vom … kommend, auf dem …. In Höhe der Grundstückseinfahrt der Klägerin kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei kontaktierte die rechte vordere Karosseriepartie des PKW des Beklagten mit dem Heck und der Anhängerkupplung des klägerischen PKW. Der genaue Unfallhergang ist zwischen den Parteien streitig.
Das klägerische Fahrzeug wurde durch den Unfall beschädigt. Die Klägerin ließ zur Bewertung des Schadens ein Gutachten bei dem Sachverständigen … erstellen (Anlage K 1, Bl. 6 – 15 d.A.). Hierfür fielen gemäß Rechnung vom 20.07.2017 758,13 € an (Anlage K 2, Bl. 16 d.A.).
Die Klägerin ließ ihr Fahrzeug reparieren. Die Reparaturkosten beliefen sich auf 7.516,62 € gemäß Rechnung vom 15.08.2017 (Anlage K 3, Bl. 17 – 18 d.A.).
Die Klägerin macht zudem eine Nutzungsausfallentschädigung in Höhe von 800,00 €, eine Auslagenpauschale in Höhe von 20,00 € sowie außergerichtliche Kosten in Höhe von 571,44 € geltend.
Die Klägerin machte mit Schreiben vom 24.07.2017 gegenüber den Beklagten Schadensersatzansprüche geltend. Die Beklagte zu 1) lehnte mit Schreiben vom 02.08.2017 eine Haftung ab.
Die Klägerin behauptet, der Beklagte zu 2) habe den Unfall verursacht, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit ungebremst – und mit den Reifen auf dem rechten Teil des Schotterweges fahrend – in das Heck ihres Fahrzeuges gefahren sei. Sie habe vor dem Zusammenstoß mit dem Beklagten zu 2) bereits einige Sekunden im Einfahrtsbereich des Grundstücks gestanden, ohne dass ein Fahrzeugteil den asphaltierten Teil der Straße erreicht habe. Die Räder seien so eingeschlagen gewesen, dass das Fahrzeugheck nach rechts gesteuert habe. Durch den Zusammenstoß sei ihr Fahrzeug um 1 bis 2 Meter versetzt worden.
Sie behauptet ferner, sowohl die Kosten für die Erstellung des Gutachtens in Höhe von 758,13 € als auch die Kosten der Reparatur in Höhe von 7.516,62 € beglichen zu haben.
Die Klägerin beantragt,
1. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie 9.094,75 € nebst Zinsen in Höhe von 5 % – Punkten über dem Basiszinssatz seit dem 02.08.2017 zu zahlen,
2. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, sie von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten der Anwaltskanzlei … zu dem Aktenzeichen … in Höhe von 887,03 € freizuhalten.
Die Beklagten beantragen, die Klage abzuweisen.
Die Beklagten behaupten, der Beklagte zu 2) sei mit angemessener Geschwindigkeit auf dem asphaltierten Straßenkörper gefahren. Die Klägerin habe vor dem Zusammenstoß ihr Fahrzeug nicht zum Stehen gebracht. Das Fahrzeugheck der Klägerin habe sich im Zeitpunkt des Zusammenstoßes schon auf dem asphaltierten Teil der Straße befunden.
Das Gericht hat die Klägerin und den Beklagten zu 2) in der mündlichen Verhandlung vom 21.03.2018 persönlich angehört. Zudem hat das Gericht Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens sowie eines schriftlichen Ergänzungsgutachtens des Sachverständigen Dipl. Ing. …. Hinsichtlich des Beweisthemas und des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf den Beweisbeschluss vom 11.04.2018 (Bl. 73 – 75 d.A.), den Beschluss vom 25.01.2019 (Bl. 148 f. d.A.), das schriftliche Sachverständigengutachten vom 28.12.2018 (Aktendeckel) sowie das schriftliche Ergänzungsgutachten vom 07.05.2019 (Aktendeckel) verwiesen.
Die Klägerin hat einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren mit Schriftsatz vom 28.05.2019, bei Gericht eingegangen am 03.06.2019 (Bl. 167 d.A.), zugestimmt. Mit Schriftsatz vom 16.05.2019, bei Gericht eingegangen am selben Tag (Bl. 165 d.A.), haben die Beklagten einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren zugestimmt.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 21.03.2018 (Bl. 67 – 69 d.A.) verwiesen.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ist unbegründet.

Die Klägerin hat gegen die Beklagten keinen Anspruch auf Schadensersatz aus §§ 7, 17 StVG, 823, 249 ff. BGB, 115 VVG i.V.m. 1 PflVG.
Zwar ist es bei dem streitgegenständlichen Unfall zu einer Kollision zwischen dem klägerischen Fahrzeug und dem Fahrzeug des Beklagten zu 2) gekommen. Ein solches Unfallereignis stellt keinen Fall höherer Gewalt im Sinne von § 7 Abs. 2 StVG dar, sodass der Haftungsausschluss nach dieser Vorschrift nicht eingreift.
Nach § 17 Abs. 1 StVG sind danach die jeweiligen Verursachungs- und Verschuldensanteile gegeneinander abzuwägen. Eine solche Abwägung ist nur dann nicht vorzunehmen, wenn das Unfallereignis für einen der Beteiligten ein unabwendbares Ereignis im Sinne von § 17 Abs. 3 StVG darstellen würde.
Der Unfall war für die Klägerin kein unabwendbares Ereignis. Für den Unabwendbarkeitsnachweis nach § 17 Abs. 3 StVG trägt derjenige die Beweislast, der sich darauf beruft. Als unabwendbar gilt ein Unfallereignis aber nur dann, wenn die äußerst mögliche Sorgfalt beachtet worden ist. Die Klägerin hat nicht nur die äußerst mögliche Sorgfalt, sondern darüber hinaus auch die verkehrserforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen, wie sich aus den nachfolgenden Ausführungen noch ergeben wird.
Es kann dahinstehen, ob der Unfall für den Beklagten zu 2) ein unabwendbares Ereignis im Sinne von § 17 Abs. 3 StVG war, da eine etwaig verbleibende Betriebsgefahr seines Fahrzeuges jedenfalls hinter dem erheblichen Verschulden der Klägerin zurücktritt.
Im Rahmen der Abwägung nach § 17 Abs. 1 StVG ist zu berücksichtigen, dass nur unstreitige, zugestandene oder bewiesene Umstände in die Abwägung einzubeziehen sind. Dabei hat grundsätzlich jede Partei, die dem Unfallgegner ein verkehrswidriges Verhalten vorwirft, den entsprechenden Nachweis zu führen.
Unter Zugrundelegung des beiderseitigen Parteivortragens und des Ergebnisses der Beweisaufnahme zum Unfallhergang spricht gegen die Klägerin der Anscheinsbeweis eines Verstoßes gegen die deutlich erhöhten Sorgfaltspflichten der §§ 9 Abs. 5 und 10 Satz 1 StVO.
Gemäß § 9 Abs. 5 StVO muss sich beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden und beim Rückwärtsfahren so verhalten werden, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen. In diesem Zusammenhang kann dahinstehen, ob das Fahrzeug der Klägerin – wie diese behauptet – zum Zeitpunkt der Kollision bereits gestanden hat, oder ob der Beklagte zu 2) in das (langsam) rückwärts fahrende Fahrzeug der Klägerin gefahren ist. Denn der Grundsatz, dass im Falle einer Kollision der Anschein gegen den Zurücksetzenden spricht (vgl. OLG München, Urteil vom 27.05.2010 – 10 U 4431/09 – juris; Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 45. Auflage 2019, § 9 StVO Rn. 51 m.w.N.), gilt auch dann, wenn der Zurücksetzende zum Kollisionszeitpunkt bereits zum Stehen gekommen ist, gleichwohl aber ein enger zeitlicher und räumlicher Zusammenhang mit dem Zurücksetzen gegeben ist (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 11.09.2012 – 9 U 23/12 – juris; OLG Köln, Urteil vom 19.07.2005 – 4 U 35/04 – juris; LG Arnsberg, Urteil vom 27.09.2005 – 5 S 58/05 – juris; a.A. BGH, Urteil vom 15.12.2015 – VI ZR 6/15 – zur Unanwendbarkeit des Anscheinsbeweises gegen den Rückwärtsfahrer bei Parkplatzunfällen, juris). Ein solcher „enger zeitlicher und räumlicher Zusammenhang“ besteht hier. Auch nach den eigenen Angaben der Klägerin ereignete sich der Unfall nach einer allenfalls sehr kurzen Standzeit ihres Fahrzeuges.
Im Übrigen ist die Klägerin hinsichtlich ihrer Behauptung auch beweisfällig geblieben. Das schriftliche Gutachten war insoweit unergiebig, da der Sachverständige nicht ausschließen konnte, dass sich die Klägerin zum Kollisionszeitpunkt noch in langsamer Rückwärtsbewegung befunden hat. Das Gericht folgt den fundierten, gut nachvollziehbaren und überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen, der dem Gericht auch aus anderen Gutachtenaufträgen als gründlich, gewissenhaft und erfahren bekannt ist.
Gegen die Klägerin spricht ferner der Anschein eines Verstoßes gegen § 10 Satz 1 StVO. Danach hat sich, wer aus einem Grundstück, aus einer Fußgängerzone, aus einem verkehrsberuhigten Bereich auf die Straße oder von anderen Straßenteilen oder über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn einfahren oder vom Fahrbahnrand anfahren will, so zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Ausweislich des unstreitigen Parteivorbringens ist die Klägerin von ihrem Grundstück rückwärts auf den … gefahren. Im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit diesem Vorgang ist es zur Kollision mit dem Beklagten zu 2) gekommen. Nach den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen befand sich die linksseitige Heckpartie des klägerischen PKW zum Kollisionszeitpunkt sogar schon knapp 0,5 m innerhalb der asphaltierten Fahrbahn des …. Bei dieser Sachlage spricht der Beweis des ersten Anscheins dafür, dass die Klägerin die aus § 10 Satz 1 StVO resultierenden äußersten Sorgfaltspflichten gegenüber dem fließenden Verkehr missachtet hat (vgl. Hentschel, a.a.O. § 10 StVO Rn. 11).
Diesen Beweis des ersten Anscheins hat die Klägerin nicht zu erschüttern vermocht.
Es ist nicht feststellbar, dass der Beklagte zu 2) seinerseits gegen eine Sorgfaltspflicht verstoßen hat. In diesem Zusammenhang kann ebenfalls dahinstehen, ob das Fahrzeug der Klägerin zum Kollisionszeitpunkt stand oder aber sich in langsamer Rückwärtsbewegung zur Straße befand. Ein Verschuldensvorwurf könnte dem Beklagten zu 2) allenfalls dann gemacht werden, wenn das Fahrzeug der Klägerin bereits zum Zeitpunkt des Herausfahrens aus dem Grundstück gut sichtbar auf der Straße gestanden hätte. In diesem Fall wäre der Beklagte zu 2) gewissermaßen „sehenden Auges“ in das Fahrzeug der Klägerin hineingefahren, was einen Verstoß gegen das allgemeine Rücksichtgebot des § 1 Abs. 2 StVO begründen würde. Dies trägt die Klägerin jedoch weder substantiiert vor noch liegen dafür objektive Anhaltspunkte vor. Bereits auf den von der Klägerin zur Akte gereichten Bildern von der Unfallstelle ist deutlich erkennbar, dass die Sichtmöglichkeiten an der Unfallstelle insbesondere aufgrund der vorhandenen Bepflanzung sowie aufgrund des Straßenverlaufes deutlich eingeschränkt sind. Zudem ist der Sachverständige in seinem Gutachten im Rahmen einer Ortsbesichtigung der Unfallstelle zu der Feststellung gekommen, dass die Sichtmöglichkeiten aufgrund eines Regenbogenverlaufs des … und eines Busch- und Baumbewuchses unmittelbar vor der Grundstückseinfahrt der Klägerin eingeschränkt sind. Darüber hinaus konnte der Sachverständige auch nicht ausschließen, dass sich die Klägerin zum Kollisionszeitpunkt noch in langsamer Rückwärtsbewegung befunden hat.
Dem Beklagten zu 2) ist auch kein Verstoß gegen die Geschwindigkeitsvorschriften der StVO (§ 3) vorzuwerfen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung beträgt im … unstreitig 50 km/h. Insoweit ist unerheblich – wie von der Klägerin behauptet -, dass angesichts der örtlichen Verhältnisse aus ihrer Sicht nur eine Geschwindigkeit von 30 km/h angemessen sei. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht auch nicht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass der Beklagte zu 2) diese Geschwindigkeit überschritten hat. Denn nach dem Ergebnis des Sachverständigen in seinem Gutachten lag die Geschwindigkeit des PKW des Beklagten zu 2) zum Kollisionszeitpunkt bei um 50 km/h.
Dem Beklagten zu 2) ist schließlich auch nicht vorzuwerfen, zu weit rechts gefahren zu sein. Zum einen gilt der Vorrang des fließenden Verkehrs, den die Klägerin hier zu beachten hatte, über die gesamte Straßenbreite. Dazu gehören vorliegend auch die befestigten Schotterstreifen. Ohnehin ist gemäß § 2 Abs. 2 StVO möglichst weit rechts zu fahren. Zum anderen steht nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass der Beklagte zu 2) überhaupt zu weit rechts gefahren ist. Nach den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen ist eine Fahrlinie des PKW des Beklagten zu 2) im rechtsseitigen Randbereich (Seitenstreifen) zum Kollisionszeitpunkt nicht feststellbar.
Das Verschulden der Klägerin überwiegt dabei in einem solchen Maße, dass die einfache Betriebsgefahr des Fahrzeugs des Beklagten zu 2) hinter das Verschulden der Klägerin vollständig zurücktritt. Nach der gefestigten Rechtsprechung des BGH tritt die einfache Betriebsgefahr regelmäßig hinter einem erheblichen Verschulden der Gegenseite zurück (vgl. BGH, NJW 2014, 3097). Gerade beim Rückwärtsfahren von einem Grundstück auf eine Straße unter Verstoß gegen §§ 9 Abs. 5, 10 Satz 1 StVO ist von einem solchen schweren Verschulden auszugehen, weil das Fließen des Verkehrs nur dann gewährleistet ist, wenn sich die mit angemessener Geschwindigkeit Vorbeifahrenden darauf verlassen können, dass nicht unerwartet jemand in die Straße hineinfährt. Die Klägerin hätte sich beim rückwärtigen Ausfahren in eine nicht gut einsehbare Straße einweisen lassen müssen. Sie hat damit in den Augen des Gerichts in eklatanter Weise sorgfaltswidrig und leichtfertig gehandelt.
Mangels Begründetheit der Hauptforderung besteht auch kein Zinsanspruch sowie ein Anspruch auf Freistellung von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 Satz 1, 2 ZPO.
Die Festsetzung des Streitwertes folgt aus § 3 ZPO i.V.m. § 48 GKG.