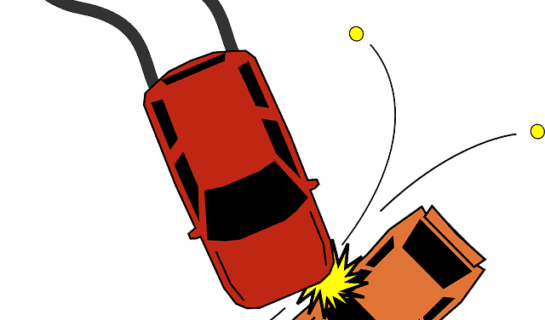AG Hamburg-Wandsbek – Az.: 716a C 332/15 – Urteil vom 04.03.2016
1. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin 2.280,46 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 09.10.2014 zu zahlen.
2. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von 293,30 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 26.08.2015 und die Beklagte zu 1) allein vom 21.08.2015 bis 25.08.2015 zu zahlen.
3. Die Beklagten haben als Gesamtschuldner die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
4. Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
Beschluss
Der Streitwert wird auf 2.280,46 € festgesetzt.
Tatbestand
Die Klägerin verlangt von den Beklagten Schadensersatz aus Anlass eines Verkehrsunfalls, der sich am … im F. Damm in H. ereignete und an dem der VW … der Klägerin mit dem amtlichen Kennzechen … und der B. der Beklagten zu 1) mit dem amtlichen Kennzeichen …, welcher bei der Beklagten zu 2) haftpflichtversichert ist, beteiligt waren.
In der Bucht der Bushaltestelle S. in dem F. Damm kam es in streitiger Weise zur Kollision zwischen den beteiligten Fahrzeugen der Parteien. Am Fahrzeug der Klägerin entstand ein Schaden hinten links. Außergerichtlich machte die Klägerin durch ihre Prozessbevollmächtigten den Schaden gegenüber der Beklagten zu 2) am 16.07.2014 geltend. Diese lehnte am 11.09.2014 jegliche Regulierung ab.
Die Klage ist den Beklagten am 20. und 25.08.2015 zugestellt worden.
Die Klägerin trägt vor, die Beklagte zu 1) sei an der Bushaltestelle auf das stehende Fahrzeug der Klägerin aufgefahren. Ihr sei dadurch ein Sachschaden in Höhe von 1.853,74 € netto entstanden. Durch Einholung eines Sachverständigengutachtens seien ihr Kosten in Höhe von 406,72 € entstanden. Neben diesen beiden Positionen verlange die Klägerin die Unkostenpauschale in Höhe von 20,- € ersetzt sowie die entstandenen Anwaltskosten in Höhe von 293,30 €.
Die Kläger beantragt,
1. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an die Klägerin 2.280,46 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 09.10.2014 zu zahlen;
2. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an die Klägerin vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von 293,30 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
Die Beklagten beantragen, die Klage abzuweisen.
Sie tragen vor, zu dem Unfall sei es gekommen, weil das klägerische Fahrzeug rückwärts gefahren sei. Die Beklagte zu 1) habe noch gehupt. Die Klägerin könne UPE-Aufschläge und Verbringungskosten nicht erstattet verlangen. Außerdem sei ein Taxenrabatt in Abzug zu bringen. Hinsichtlich der Sachverständigenkosten dürfte wegen der erfolgten Abtretung des Anspruchs an den Sachverständigen der Klägerin die Aktivlegitimation fehlen. Anwaltskosten können zudem nur verlangt werden, soweit eine Rechnung gemäß § 10 RVG vorliege und die Klägerin diese auch bezahlt habe.
Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Das Gericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf den Inhalt der Sitzungsniederschriften vom 23.10.2015 und 29.01.2016 Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ist gemäß den §§ 823 BGB, 7, 17 StVG, 115 VVG begründet.
I.

Der Unfall hat sich beim Betrieb des B. der Beklagten zu 1) ereignet. Unabwendbar war der Unfall für die Beklagte zu 1) nicht, weil ihr ein schuldhafter Verstoß gegen § 9 V StVO anzulasten ist.
Nach Durchführung der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass es zum Unfall gekommen ist, als die Beklagte zu 1) gerade dabei war zu wenden und dabei in der Bucht der Bushaltestelle gegen die linke hintere Seite des stehenden VW … der Klägerin gefahren ist. Hiervon ist das Gericht nach den Aussagen der Zeugen überzeugt. Die Beklagte zu 1) hat dabei im Rahmen der persönlichen Anhörung gemäß § 141 ZPO selbst ausgeführt, dass sie aus der Gegenrichtung gekommen sei und gewendet habe. Sie sei dabei schräg auf die Bushaltestelle gefahren. Auch der hierzu vernommene Zeuge B. hat bekundet, dass das Fahrzeug der Beklagten zu 1) nahezu im rechten Winkel zum F.-Damm gestanden habe und offensichtlich war, dass die Beklagte zu 1) gerade gewendet habe. Von einem Auffahrunfall, der einen achsparallelen Anstoß mit jedenfalls 2/3-Überdeckung der Fahrzeuge voraussetzt, kann daher ohnehin nicht die Rede sein.
Nach den Ausführungen der Zeugen B. und R. ist das Gericht jedoch nicht davon überzeugt, dass der V. der Klägerin an der Unfallstelle zurücksetzte. Beide Zeugen haben übereinstimmend bekundet, dass der Zeuge B., der das Fahrzeug bis zur Bushaltestelle gelenkt hat, dieses an den Zeugen R… übergeben wollte. Beide Zeugen sind Taxifahrer. Der Zeugen B. fuhr die Tagschicht, während der Zeuge R. die Taxe zur Nachtschicht übernehmen wollte. Rückwärts sei die Taxe zu keiner Zeit gefahren worden. Beide Zeugen haben ihre Aussagen ohne eine Tendenz oder ein Bemühen nach einer bestimmten Aussage gemacht. Erinnerungslücken haben sie eingeräumt. Beide Aussagen waren glaubhaft. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, an der Glaubwürdigkeit der Zeugen zu zweifeln. Insbesondere bestand auch keine Veranlassung, das Fahrzeug zurückzusetzen. Selbst wenn der Zeuge B. den Motor der Taxe im Zeitpunkt der Kollision noch nicht ausgeschaltet haben sollte und der Automatikhebel des Fahrzeugs noch nicht auf P gestanden haben sollte, hätte der Wagen bei der Einstellung D nicht „versehentlich“ zurückrollen können. Auch zur Weiterfahrt von der Bushaltestelle – obwohl der Fahrerwechsel noch bevorstand – wäre ein Vorwärtsfahren deutlich bequemer gewesen. Bei der Zeugin S. demgegenüber hat das Gericht schon erhebliche Zweifel, ob die Zeugin zur Unfallzeit überhaupt in der Nähe des Unfallortes gewesen ist. Die Zeugin machte bei ihrer Aussage einen derart fahrigen und nervösen Eindruck. Wenn die Zeugin bestimmte Entfernungen einschätzen oder Abläufe wiedergeben sollte, relativierte sie stets ihre einmal gemachten Angaben, um sich möglichst nicht festlegen zu müssen. Nur daran, dass am Fahrzeug der Beklagten zu 1) durchgehend die Bremsleuchten und der Taxe der Klägerin die Rückleuchten leuchteten, will sich die Zeugin sehr genau erinnert haben. Auch dem Gericht erscheint es lebensfremd, dass die Zeugin nicht anhält, wenn sie bemerkt, dass eine Freundin in einen Unfall verwickelt ist. Das Gericht ist von der Glaubwürdigkeit der Zeugin nach alledem nicht überzeugt. Der ebenfalls vernommene Zeuge Sch… konnte keine Angaben zur eigentlichen Kollision machen, da er erst auf die beteiligten Fahrzeuge aufmerksam wurde, als der Unfall bereits geschehen war. Zu keiner Zeit habe er ein Fahrzeug in Fahrt gesehen.
Nach dem sich nach der Beweisaufnahme herausgestellten Sachverhalt ist es beim Wenden der Beklagten zu 1) zu dem Unfall gekommen. Das eigentliche Wenden ist erst mit dem Erreichen der Gegenrichtung vollendet. Die Fahrtrichtung – auch des klägerischen … – hatte die Beklagte zu 1) noch nicht vollständig erreicht. Dies ergibt sich – wie ausgeführt – auch aus ihren eigenen Schilderungen. Die Beklagte zu 1) war bei ihrem gefahrenträchtigen Wendemanöver nach § 9 V StVO verpflichtet, auf die übrigen Verkehrsteilnehmer unter Wahrung der äußersten Sorgfalt zu achten. Da es gleichwohl zu dem Unfall gekommen ist, spricht bereits der Beweis des ersten Anscheins dafür, dass die Beklagte zu 1) die ihr obliegende Verpflichtung, nämlich die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen, gerade nicht gewahrt hat. Der Beweis des ersten Anscheins ist nicht entkräftet.
II.
Der Unfall hat sich auch beim Betrieb des VW … der Klägerin ereignet (§ 7 I StVG). Ob der Unfall für die Klägerin unabwendbar war, kann dahingestellt bleiben. Denn eine Mithaftung der Klägerin käme angesichts des Verstoßes der Beklagten zu 1) gegen § 9 V StVO nur in Betracht, wenn den Fahrer B. ein Mitverschulden getroffen hätte. Ein solches ist aber nicht feststellbar.
Die Klägerin kann den ihr entstandenen Schaden zu 100 % ersetzt verlangen. Denn bei der Abwägung nach § 17 StVG wiegt die durch das Verschulden der Beklagten zu 1) erhöhte Betriebsgefahr ihres B. so schwer, dass demgegenüber die nur einfache Betriebsgefahr des VW … der Klägerin völlig zurücktritt.
III.
Die Klägerin kann den geltend gemachten Sachschaden in Höhe von 1.853,74 € netto von den Beklagten ersetzt verlangen. Auch bei fiktiver Abrechnung sind UPE-Zuschläge und Verbringungskosten zu erstatten, da sie bei Reparaturen in VW-Fachwerkstätten regelmäßig anfallen. Ein Taxenrabatt ist demgegenüber nicht zu berücksichtigen, da die Klägerin als Auftraggeberin des Reparaturauftrages diesen Rabatt nicht erhalten wird, da sie kein Taxenunternehmer ist.
Nach Rückabtretung des Schadensersatzanspruchs auf Erstattung der Sachverständigenkosten (Anlage K9) an die Klägerin stehen ihr diese in Höhe von 406,72 € zu.
Die Unkostenpauschale im Umfang von 20,- € ist der Höhe nach zwischen den Parteien unstreitig. Die drei Positionen ergeben den zugesprochenen Gesamtbetrag in Höhe von 2.280,46 €.
Der Zinsanspruch folgt aus den §§ 286 II Ziffer 3 BGB, 288 I BGB.
Außergerichtliche Anwaltskosten in Höhe von 293,30 € stehen der Klägerin gemäß den §§ 249 I, 250 BGB zu. Auch wenn die Klägerin selbst die Anwaltskosten noch nicht an ihre Prozessbevollmächtigten gezahlt hat, wandelte sich der ihr zustehende Freistellungsanspruch gemäß § 257 BGB in einen Zahlungsanspruch um, nachdem die Beklagte zu 2) eine Regulierung endgültig – nicht zuletzt in dem vorliegenden Rechtsstreit – ablehnte. Einer Fristsetzung gemäß § 250 BGB bedurfte es nicht mehr. Darauf, dass oder ob die Klägerin von ihren Prozessbevollmächtigten eine Rechnung, die die Anforderungen des § 10 RVG erfüllt, erhalten hat, kommt es für die Frage der Erstattungsfähigkeit der Anwaltskosten durch Dritte nicht an. Denn § 10 RVG betrifft ausschließlich das Mandantenverhältnis (vgl. LG Berlin vom 27.01.2010 – 2/16 S 162/09).
Der Zinsanspruch auf die Anwaltskosten folgt aus den §§ 288 I, 291 BGB.
IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 I ZO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 S. 1 ZPO.